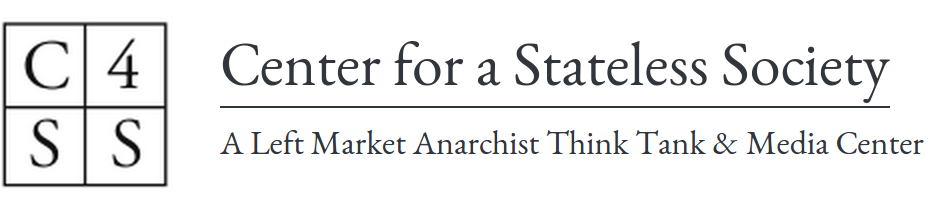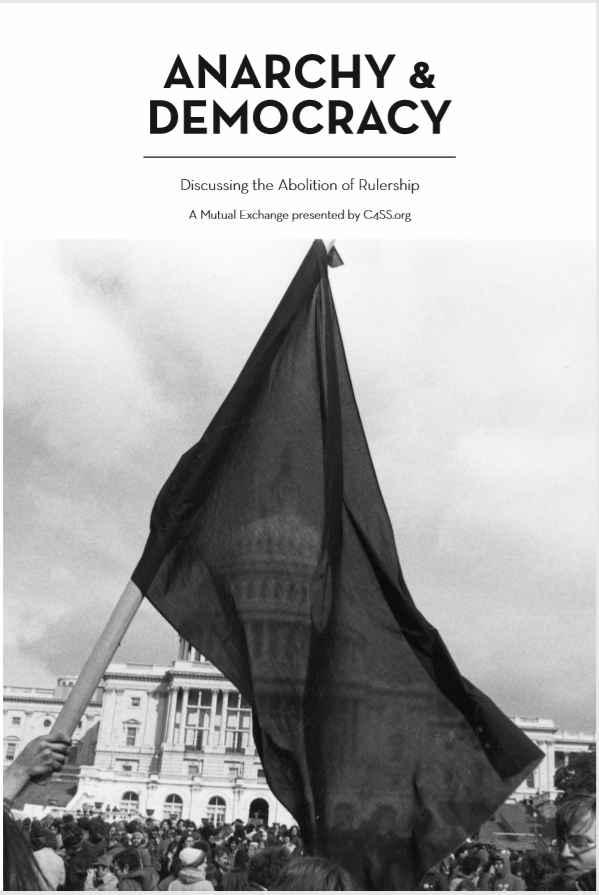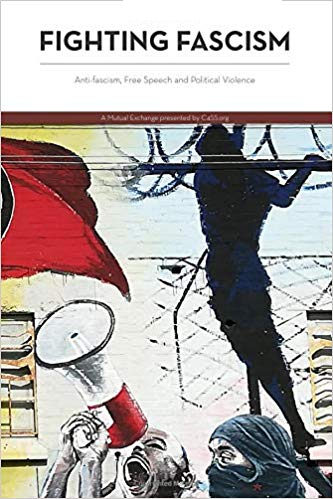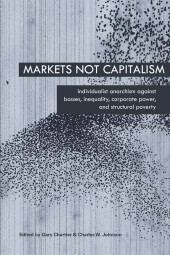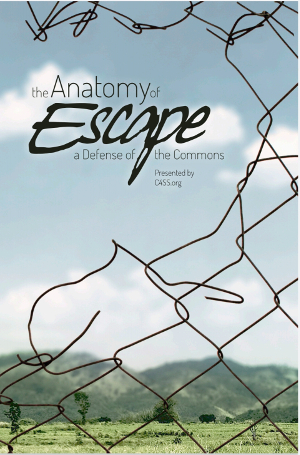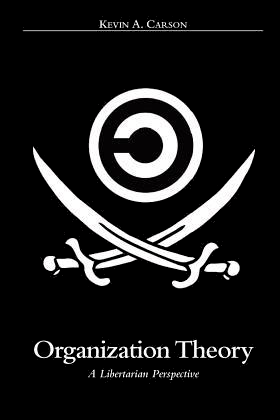Gehen Sie zu einer durchschnittlichen libertären Veranstaltung an einem beliebigen Tag, und es ist wahrscheinlich, dass Sie ausführliche Verteidigungen für unternehmerische Globalisierung, Wal-Mart, Offshoring, Nike’s Sweatshops, steigende CO2-Pegel, Einkommensunterschiede und Wohlstandskonzentration, Managergehälter, Pharmaprofite und Microsofts Marktanteil sehen werden, alle basierend auf Prinzipien des „freien Marktes“ – verbunden mit energischem Bestreiten aller wahrgenommenen Übel korporatistischer Macht, da (wie es Henry Hazlitt in einigen Passagen von PDF – Economics in One Lesson erklärt) die Prinzipien des „freien Marktes“ dies nicht erlauben würden.
Diese letzte Beschreibung ist, was ich „vulgären Libertarismus“ nenne. Sie bezieht sich auf das Unvermögen einiger libertärer Kommentatoren sich, von einem Moment zum anderen, daran zu erinnern, ob sie Prinzipien des freien Marktes als solche verteidigen oder lediglich eine zynische Entschuldigung für die Interessen großer Unternehmen und der Plutokratie, verhüllt in falsche Rhetorik eines „freien Marktes“, abgeben. Der vulgär-libertäre Kommentator wird oft prinzipiell die Existenz korporatistischer, betrügerischer Absprachen anerkennen und zugeben, dass die gegenwärtige Wirtschaft auf vielfältige Weise von einem freien Markt abweicht, wovon die großen Unternehmen profitieren, doch kurz danach wird er umschalten und damit fortfahren, die gegenwärtige Größe und den Wohlstand der großen Unternehmen auf der Basis von „wie unsere freie Marktwirtschaft funktioniert“ zu verteidigen. Das vulgär-libertäre Argument hängt davon ab, eine fragwürdige Stellung dazu einzunehmen, ob die existierende korporatistische Wirtschaft eine freie Marktwirtschaft ist oder nicht, um dann die Position derart zu wechseln, dass daraus ein Argument im Sinne des Big Business wird.
Ein gutes Beispiel hierfür erschien kürzlich auf dem Mises Blog: „A Marketplace to Loathe.“ Ich sollte im Voraus erwähnen, dass der Autor (Christopher Westley) korporatistisches Rent-Seeking in anderen Artikeln eingeräumt hat. Er gab im Kommentarbereich zu, dass Konzerne im Bunde mit dem Staat eine Bedrohung sein könnten, und entschuldigte sich dafür, dass er dies möglicherweise nicht in seinem Artikel klargestellt hatte. Er erklärte mir zudem, in einer sehr höflichen E-Mail, dass das Ziel seiner Attacke die unhinterfragte linke Annahme war, korporatistische Macht sei eher das normale Produkt eines freien Marktes als staatlicher Intervention in den Markt. Und er versicherte mir, dass er, anders als viele Kommentatoren im Kommentarbereich des Artikels, meine Entgegnungen nicht als Erbsenzählerei angesehen hat. Lassen Sie mich also klarstellen, dass ich sein Argument weder als bösartig noch als vorsätzlich unehrlich betrachte (obwohl ich erhebliche Vorbehalte gegenüber einigen der Kommentatoren habe).
Nichtsdestotrotz beinhaltet sein ursprünglicher Artikel keine dieser Nuancen, die er später festgelegt hat. Er erhebt nicht einmal die Frage, ob es sich um einen freien Markt handelt oder nicht, oder behandelt diese Frage als den entscheidenden Streitpunkt zwischen Libertären und Linken. Daher ist sein ursprüngliches Argument auf den ersten Blick ein vulgär-libertäres.
Der Gegenstand seines Artikels war ein Kommentar auf NPR’s Marketplace Programm. Hier ist der Abschnitt, den er zitierte:
Ich habe eine Bitte. Können Sie bitte tun was notwendig ist um den Glauben an die Unternehmen wiederherzustellen, ein Glaube, der in den letzten Jahren sehr beschädigt wurde? Die großen Türme, die unsere Unternehmen beherbergen, sind die neuen Paläste unserer Zeit, die Orte, an denen sich wirkliche Macht befindet, doch diese Türme sind voller Paradoxe. Gemacht aus Glas, kann man nicht hineinsehen. Sie sind die Säulen unserer Demokratie, doch sie werden wie totalitäre Staaten geführt. Ihre Namen sind reduziert zu einer Menge von Initialen. Ihre Führer sind der Außenwelt unbekannt. Sie sind haftbar, zum größten Teil, gegenüber anderen Institutionen, die sich in ähnlichen anonymen Türmen befinden. Für den Durchschnittsmenschen sind sie fremde Gebilde, eingehüllt in Geheimnisse. Es ist nicht verwunderlich, dass wir sie mit Argwohn betrachten, berührt mit Neid.
Westleys Erwiderung:
… Selbst das größte Unternehmen hat keine Macht über das Individuum, es sei denn das Individuum gewährt diese, somit … kann der Konsument General Motors eine lange Nase machen und GM kann nichts tun als stärker zu versuchen ihm gefällig zu sein, wenn es seinen Auftrag möchte.
Auch wenn es nur, nebenbei bemerkt, sekundär ist, kann ich es nicht unterlassen Westleys Charakterisierung von Marketplace als eine „marxistische Wirtschaftsshow“ und seine Bezeichnung des Kommentators – Charles Handy – als den „Kommunisten des Tages“ zu kommentieren. Der „Marketplace“ –Homepage zufolge ist Handy ein „London Business School“-Gründer und ein „Claremont Graduate University’s Drucker School of Business Professor…“ Dies lässt mich glauben, dass, wie sehr Handy auch den interventionistischen Staat unterstützten mag, er dies nicht aus einer marxistischen Perspektive heraus tut. (Ebenso wie die britischen besitzenden Klassen, die für das Enclosure gestritten haben aufgrund dessen, dass die arbeitenden Klassen nur dazu gezwungen werden konnten härter zu arbeiten, wenn sie von ihrem Land vertrieben wurden, auch keine Marxisten waren.) Roy Childs‘ Beobachtung, dass linke Intellektuelle – historisch – öfter die Lakaien des Big Business waren, ist vermutlich näher am Ziel. Ich denke es ist gefahrlos zu sagen, dass Handy eine Gesellschaft als normal ansieht, in der große Unternehmen die „Säulen unserer Demokratie“ sind, und lediglich die korporatistische Herrschaft stabilisieren will. Und für all seinen zweifelsfrei aufrichtigen Glauben mit seinen eigenen progressiven Beweggründen laufen die meisten der „reformerischen“ Maßnahmen, die er empfiehlt, praktisch auf das hinaus, was der New Leftist Gabriel Kolko in The Triumph of Conservatism „politischen Kapitalismus“ nennt:
Politischer Kapitalismus ist die Nutzung politischer Ventile, um zu Bedingungen zu gelangen, die Stabilität, Vorhersehbarkeit und Sicherheit – um Rationalisierung zu erreichen – zu gewährleisten… [Mit Rationalisierung] meine ich … die Organisation der Wirtschaft und der weiteren politischen und sozialen Sphären in einer Weise, die Unternehmen erlaubt in einer vorhersehbaren und sicheren Umgebung zu arbeiten, die es zulässt, angemessene Profite auf lange Sicht zu erzielen.
Ich bin sicher, dass Handy die schlechten Aspekte korporatistischer Macht als Ergebnisse eines unregulierten Marktes sieht (als Gegensatz dazu, alle korporatistische Macht und die diese bedingende staatliche Intervention als an sich schlecht anzusehen). Doch dieses Problem taucht erst gar nicht in Westleys Artikel auf. Er zitierte lediglich einen Hinweis auf totalitäre korporatistische Macht, um dann zu bestreiten, dass diese überhaupt existieren kann, da das nicht die Weise ist, wie der freie Markt arbeitet (arbeitet, Präsenz Indikativ, nicht würde arbeiten). Gleichwohl er es später klarstellte, zitierte sein ursprünglicher Artikel lediglich einen Hinweis auf korporatistische Macht und antwortete mit einer Gegenbehauptung, dass korporatistische Macht nicht existieren kann – da der „freie Markt“ es nicht erlauben würde.
Jedenfalls war dies die Kernaussage meines Kommentars unter dem Artikel:
GM und andere Unternehmen können (und tun es auch!) betrügerische Absprachen mit dem Staat vereinbaren, um Marktbarrieren zu errichten und den Umfang von Wettbewerb zu begrenzen.
Also sollten Sie tatsächlich nicht sagen, dass die größten Unternehmen „keine Macht haben“, sondern dass die größten Unternehmen „in einem freien Markt keine Macht haben WÜRDEN.“
Und da dies kein freier Markt ist sondern vielmehr (wie Rothbard es formulierte) ein korporatistischer Staat, der die Akkumulation von Kapital und die Geschäftskosten des Big Business subventioniert, lag der Radiokommentator vollkommen richtig mit der Macht, die in solchen korporatistischen Türmen ausgeübt wird.
Sie sollten ergründen, was Ihre eigentliche Absicht ist: Prinzipien des freien Marktes als solche zu verteidigen, oder lediglich die Profite und Macht des Big Business unter dem Anschein von Prinzipien des „freien Marktes“ zu verteidigen.
Mehrere reguläre Mises Blog Kommentatoren reagierten unverzüglich auf meine Kritik, auf etwas fragwürdige Weise. Einer von ihnen wartete mit diesem Juwel auf:
Wann kommen Sie über dieses gleiche, müde Argument hinweg? Muss der Autor jede Bemerkung würdigen? Ist dies eine wissenschaftliche Fachzeitschrift oder ein Blogartikel?
Ja, Kevin, wir leben nicht in einem freien Markt.
Ja, Kevin, viele (wenn nicht alle) Unternehmen machen Lobby für und akzeptieren Almosen.
Oh warte, was ist das? Es ist ein Wal-Mart Artikel den Sie nicht für seinen Mangel an „dies ist kein freier Markt“-Eignung gescholten haben. Los, jag ihn, Fido! Tschüss.
Während ich denke, dass es vertretbar ist, Westley seine Ehrlichkeit und guten Absichten anzurechnen, sind die Kommentatoren jedoch ein völlig anderer Fall.
Ich bin äußerst verblüfft, dass 1) ein Kommentator einen Hinweis auf korporatistische Macht machen kann; 2) ein Kritiker ihn aufgrund der unmöglichen Existenz von korporatistischer Macht auf einem „freien Markt“ als „Marxisten“ ablehnen kann; und 3) die Verteidiger des Kritikers die Frage, ob ein freier Markt tatsächlich existiert oder nicht, als eine Wortklauberei und Ablenkung abweisen und die Person, die sie gestellt hat, beschuldigen können, die Symmetrie des schönen Arguments des Kritikers mit einem Bündel gemeiner, alter Fakten zu verderben. Wenn Partei A auf die Existenz korporatistischer Macht hinweist und Partei B die Gegenbehauptung aufstellt, dass Unternehmen keine Macht in einem freien Markt haben (nicht „haben könnten“), ist die Frage, ob tatsächlich ein freier Markt überhaupt existiert, keine reine Wortklauberei. Sie ist der zentrale Streitpunkt um zu ergründen, ob die Behauptung der Partei A richtig oder falsch ist, oder ob Partei B ihr eine Entschuldigung schuldet.
Aber betrachten wir das Ganze einmal allgemeiner. Obwohl Handy nicht – in der von Westley zitierten Passage – explizit korporatistische Macht als das natürliche Ergebnis des Marktes behandelt oder für Staatsintervention als einzige Möglichkeit zur Verhinderung selbiger plädiert, implizierte er es jedoch stark in dem vollen Kommentar, woraus sie herausgezogen wurde. Doch Westley machte nicht das Ausmaß der Rolle der Regierung bei korporatistischer Macht zum Gegenstand seines Artikels; er leugnete lediglich, vollkommen, dass korporatistische Macht existiert, basierend darauf, wie der Markt funktioniert.
Aber was wenn Handy tatsächlich, und ich denke, es ist wahrscheinlich, implizit annimmt (was ich als die typische vulgär-linke Annahme betrachte), dass der freie Markt in korporatistischer Macht resultiert, wenn der Staat nicht zur Verhinderung interveniert: was – dies ist dann die effektivste Antwort – wenn unser Ziel die Förderung libertärer Ideen in der Gesellschaft als Ganzes ist? Nicht, wie Westley es tat, reflexmäßig die Ehre des Big Business verteidigen und leugnen, dass korporatistische Macht existiert.
Die effektivste Antwort wäre etwas Ähnliches wie:
Ich stimme mit Ihnen überein, dass korporatistische Macht existiert, und teile Ihre Sorge bzgl. ihrer üblen Auswirkungen, aber ich glaube, dass Sie hinsichtlich der Gründe und der Lösung falsch liegen. Die üblen Auswirkungen korporatistischer Macht resultieren nicht aus dem staatlichen Versagen, Big Business einzuschränken, sondern weil die Regierung es überhaupt erst aufgerichtet hat: Diese staatliche Unterstützung beinhaltet Subventionen für die Geschäftskosten des Big Business und den Schutz des Big Business vor dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb durch Markteintrittsbarrieren, regulatorische Kartelle und spezielle Privilegien wie sogenanntes „geistiges Eigentum“.
Eine libertäre Bewegung, die die öffentliche Sorge über wirklich reale Probleme, offensichtlich für jeden mit Augen im Kopf, ablehnt durch doktrinäre Verneinungen, dass diese existieren oder nicht existieren, ist eine libertäre Bewegung, die zur Irrelevanz verdammt ist.
Hier ist was Mises schrieb, in Epistemological Problems of Economics, über offenkundige Konflikte der Theorie mit der Erfahrung:
Wenn ein Widerspruch auftaucht zwischen der Theorie und der Erfahrung müssen wir immer annehmen, dass eine Bedingung, zuvor vermutet von der Theorie, nicht vorhanden war, oder dass es einen Fehler in unserer Beobachtung gibt. Die Unstimmigkeit zwischen der Theorie und den Fakten der Erfahrung zwingen uns regelmäßig die Probleme der Theorie wieder zu durchdenken. Doch solange ein Umdenken der Theorie keine Fehler in unserem Denken enthüllt, sind wir nicht befugt, ihre Wahrheit anzuzweifeln.
Die Vulgär-Libertären hinterfragen jedoch weder ihre Anwendung von Mises‘ Theorie noch ihr Verständnis der Fakten. Stattdessen fordern sie uns heraus: „Wem werden Sie glauben: Mises oder Ihren lügenden Augen?“
Wir wissen alle, dass korporatistische Macht existiert. Jede libertäre Bewegung, die auf mehr hofft als auf Selbst-Marginalisierung, muss direkt die Wahrnehmung des gesunden Menschenverstandes, dass korporatistische Macht existiert, und die öffentlichen Sorgen, die darauf beruhen, ansprechen und erklären, warum der Markt gut und der Staat schlecht ist bei diesem Problem.
Der Ansatz, den ich bei zu vielen durchschnittlichen libertären Veranstaltungen sehe, ist das moralische Äquivalent zu jemandem, dessen Haus abbrennt, zu sagen: „Dein Haus kann nicht abbrennen, weil Häuser nicht ohne Sauerstoff abbrennen können, du dreckiger Kommunist!“ – um dann die Frage, ob tatsächlich Sauerstoff in der Luft ist, als „Wortklauberei“ abzulehnen.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Übel des staatskorporatistischen Nexus, direkt resultierend aus der Größe der Unternehmen und der Macht, die dadurch aufkommt, die zentralen Probleme und Sorgen für einen Durchschnittsmenschen darstellen. Ein viel zu großer Anteil der gegenwärtigen libertären Bewegung lehnt diese Sorgen als motiviert durch „ökonomischen Analphabetismus“ ab (obwohl ihre eigene wirtschaftsfreundliche Verteidigung womöglich offener für diese Anschuldigung ist), um dann umzuschwenken zu dem, was als wirkliche, nach Lösung schreiende Probleme von Ungerechtigkeit gesehen wird: dreiste Gewerkschaftsmitglieder, Sozialhilfeempfänger, die sich in ihrem Luxus wälzen, und „Strafverteidiger“.
Für zu viele durchschnittliche Libertäre sind die Übel staatskorporatistischer betrügerischer Absprachen etwas anerkennenswertes, und korporatistische Wohlfahrt ist irgendwie schlecht, prinzipiell, denke ich, und vielleicht sollten wir eines Tages etwas dagegen tun … . Aber Wohlfahrt, die den Armen hilft statt den Reichen, ist flammendroter Ruin auf Rädern!
Und so historisch unbewandert und unlogisch wie einige Kommentatoren bei Daily Kos auch sind, wenn sie ihre oberflächlichen „pot-smoking Republicans“ Abweisungen von Libertarismus machen: Wenn man es sich genau anschaut, können sich durchschnittliche Libertäre hierfür nur selbst Vorwürfe machen. Statt die historische Unkenntnis und Unlogik mit durchdachten Argumenten anhand dem oben von mir Beschriebenen anzusprechen – die Rolle, die der Staat in der Schaffung und Bewahrung von korporatistischer Macht gespielt hat, und wie der Markt diese bedroht – leugnen durchschnittliche Libertäre lediglich, dass korporatistische Macht überhaupt existiert und untermauern diese Position mit ähnlicher historischer Unkenntnis und Unlogik. Wenn ich denken würde, dass „freie Märkte“ und „freier Handel“ wirklich das meinen würden, was neoliberale Fernsehsprecher damit meinen, würde ich sie auch hassen.
Tatsächlich gibt es große Gemeinsamkeiten zwischen der vulgär-libertären und der vulgär-linken Interpretation der Geschichte. Sowohl der typische Stammgast des Mises Blog als auch der typische Daily Kos Kommentator würde übereinstimmen, dass die gigantischen Konzerne des zwanzigstens Jahrhunderts aus dem „laissez-faire“ Markt des neunzehnten Jahrhunderts entstanden sind, und dass sich im zwanzigsten Jahrhundert eine gemischte Ökonomie aus dem Versuch entwickelt hat, Big Business einzuschränken. Der einzige Unterschied ist, ob entweder Big Business oder Big Government das „Gute“ darstellen.
Der ursprüngliche Artikel wurde geschrieben von Kevin Carson und veröffentlicht am 10. März 2008.
Übersetzt aus dem Englischen von Achim Fischbach.